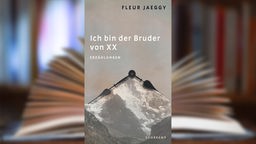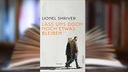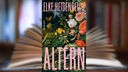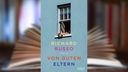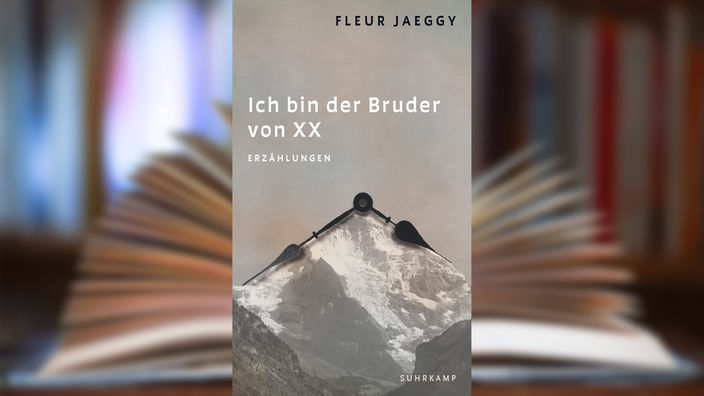
"Ich bin der Bruder von XX" von Fleur Jaeggy
Stand: 20.06.2024, 07:00 Uhr
Es wird gestorben und getötet, Einsamkeit und Horror werden durchlitten, Wahnsinn und Schweigen – Fleur Jaeggy erzählt in "Ich bin der Bruder von XX" in einer berückend kühlen Sprache von den Abgründen des Menschen, von der Sinnlosigkeit und der Schönheit des Schmerzes. Eine Rezension von Ulrich Rüdenauer.
Fleur Jaeggy: Ich bin der Bruder von XX
Aus dem Italienischen von Barbara Schaden.
Suhrkamp, 2024.
114 Seiten, 22 Euro.
In einer der 20 Prosaminiaturen, die in Fleur Jaeggys Band "Ich bin der Bruder von XX" versammelt sind, macht der Dichter Joseph Brodsky einen nächtlichen Spaziergang durch Brooklyn. Hier, in seinem New Yorker Exil, fühlt er sich Leningrad nahe; die peitschende Luft und die eisige Temperatur erinnern ihn an die verlorene Heimat, der East River an den Fluss Newa.
Jaeggy bleibt ihm dicht auf den Fersen und auch auf den dichterischen Versen; sie schmiegt sich an ihn an oder schlüpft sogar in ihn hinein, aber ohne dabei aufdringlich, gefühlig oder sogar übergriffig zu sein. Ihr Ton bleibt lakonisch und kühl.
"Er geht zerstreut dahin, fast fern von sich. Die Zerstreutheit verhindert nicht, dass sein melancholischer Blick wachsam bleibt. Worte, Landschaften, Schweigen, würde Herr Frost sagen. Ist es womöglich das, was den Dichter macht, Eis und Kälte?"
Vermutlich würde Fleur Jaeggy zustimmen – Eis und Kälte gehören zum Dichten; Düsternis dürfte sie wohl noch hinzufügen; "Worte, Landschaften, Schweigen" sind weitere notwendige Ingredienzien, wie sie den Lyriker Robert Frost zitiert, der in einer anderen Geschichte noch einmal Erwähnung findet.
Hat Brodsky den Text "Negde" – "Negde" heißt auf Russisch "Nirgends" – inspiriert, so Ingeborg Bachmann die kurze Erinnerung "Das aseptische Zimmer". Oder Oliver Sacks die Geschichte "Eine Begegnung in der Bronx". Darin besucht die Erzählerin mit dem berühmten Neurologen und einem gemeinsamen Freund ein Restaurant. Statt aber über diese Begegnung und das Gespräch mit Oliver Sacks zu berichten, ist sie von einem Fisch gebannt, der im Aquarium schwimmt, aus dem sich die Gäste ihr Abendessen aussuchen können.
"Der Fisch bewegt sich. Immer dieselbe Strecke. (…) Sie kommen, um ihn aus der Nähe zu betrachten. Noch ist er frisch. Weil er lebt. Alle Gäste können sicher sein, dass der Fisch frisch ist. Jeder kann sich vergewissern. Und sie, die Fische, äugen nach ihnen. Verzweifelt, gleichgültig, keine Ahnung. Aber ich verspürte eine Geschwisterlichkeit zwischen ihnen und mir, besonders bei einem. Ihn habe ich in deutlichster Erinnerung. Ich erinnere mich an seine Gestalt. Seinen Blick. Ich kann ihn nicht retten. Ich verlasse das Restaurant, nachdem ich mich von ihm verabschiedet habe. Ich sage ein paar Worte der Zuneigung. Ich bewege meine Lippen. Wie er. Und adieu."
Hier zeigt sich, was die Prosaminiaturen und Erzählungen Fleur Jaeggys ausmacht: Nicht nur nehmen sie kaum vorhersehbare Verläufe; sie werden, so banal die Ausgangskonstellation sein mag, heruntergebrochen auf eine existenzielle, mitunter äußerst irritierende Situation. Die Texte über Brodsky, Bachmann oder Sacks gehören dabei zu den eher zugänglicheren der versammelten Prosastücke.
Meist aber entsteht beim Lesen ein Unbehagen, weil Jaeggy auf faszinierend abstrakte und beiläufige Weise mit der Sinnlosigkeit spielt. Etwa wenn sie ein Kind zur "Vernichterin" macht – aufgenommen vom wohlhabenden und wohlwollenden Fräulein von Oelix, zur Alleinerbin erkoren, gekost und umhegt, betrachtet das Mädchen mit Genugtuung, wie die Wohnung des Fräuleins und das Fräulein selbst zum Opfer eines Brandes werden.
"Das Kind besaß einen enormen Willen. Und ebensolche Entschlossenheit. Es wollte die Zerstörung dieser Frau, die ihm Gutes tat. Zerstören um eines verfluchten Ruhmes willen. Es will kein Geld. Es will zerstören. Sollte es etwa auf ein lächerliches Warum antworten? Weil alle Welt glaubt, es gebe ein Warum hinter dem Tun oder Wollen des Menschen. Einen Grund. Dabei ist jeder Vorwand einladend. Ohne Motiv. Wut, Heiligkeit, Langeweile."
Ob ihre Texte in einem brandenburgischen Dorf spielen oder in der Gedenkstätte Auschwitz, ob im 13. Jahrhundert oder in der Gegenwart – es herrscht in ihnen eine Trost- und Aussichtslosigkeit, und zugleich immer eine solch geheimnisvolle Stimmung und Unergründlichkeit, dass man sie mit Faszination liest. Das hängt nicht zuletzt an ihrer Strenge, an ihrem frostigen Ton. Knapper Hauptsatz reiht sich an Hauptsatz. Jegliche Ausschmückung wird vermieden. Die Kargheit des Stils entspricht der Kargheit der Gefühle, die aber unter einer eisigen Oberfläche umso feuriger zu lodern scheinen.
Für das Tun der Figuren gibt es kaum Gründe. Es herrscht manchmal der reine Instinkt, etwas Archaisches. Der Schrecken ist dem Menschen eingeschrieben, und er verbreitet ihn zugleich, scheint uns diese Prosa in verschiedenen Variationen und Formen sagen zu wollen. In seiner Konsequenz ist das beeindruckend. Vielleicht sollte man die Erzählungen aber dosiert zu sich nehmen – um nicht dem "dark frenzy of horror" zu erliegen, wie es einmal nach Thomas de Quincey heißt, dem "dunklen Rausch des Grauens".