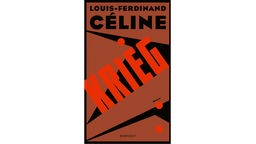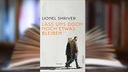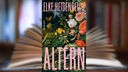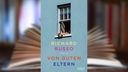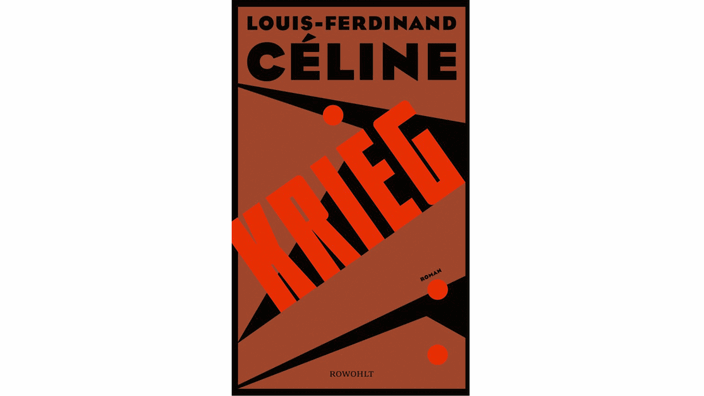
"Krieg" von Louis-Ferdinand Céline
Stand: 12.09.2023, 07:00 Uhr
Genialer Spracherneuerer und rechter Judenfeind – an Louis-Ferdinand Céline scheiden sich die Geister. Ein Jahrzehnte nach dem Tod des französischen Schriftstellers unter spektakulären Umständen aufgetauchtes Manuskript liegt jetzt auf Deutsch vor: der Roman "Krieg". Eine Rezension von Dirk Fuhrig.
Louis-Ferdinand Céline: Krieg
Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel.
Rowohlt Verlag, 2023.
192 Seiten, 24 Euro.
Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg
"Seit Dezember 14 habe ich immer in so grässlichem Lärm geschlafen. Der Krieg hat mich im Kopf erwischt. Er ist in meinem Kopf eingesperrt."
Ein Soldat irrt nach einer Schussverletzung über das Schlachtfeld. Seine Kameraden sind tot, er schleppt sich zu einem Lazarett:
"Weitere Kilometer. Wieder Blut geschluckt. […] Alles drehte sich. Scheiße, habe ich gedacht, Ferdinand. Du wirst doch jetzt nicht verrecken, wo du das Schlimmste hinter dir hast!"
Ferdinand heißt dieser Ich-Erzähler – so wie schon der Protagonist in Célines ersten Roman "Reise ans Ende der Nacht". Damit hatte der Arzt Louis Ferdinand Destouches 1932 einen kometenhaften Aufstieg zum gefeierten Schriftsteller unter dem Pseudonym Louis-Ferdinand Céline hingelegt. Seine unmittelbar geschilderten Erlebnisse aus dem Kleinbürgermilieu, in dem er aufwuchs, und aus dem Ersten Weltkrieg, in dem er als Freiwilliger diente, erschütterten die Leserschaft.
Drastischen Beschreibungen
Auch der Roman "Krieg", der um 1934 entstand und der jetzt erstmals auf Deutsch vorliegt, ist gespickt mit drastischen Beschreibungen des Schlachtenelends, aber auch mit vielerlei Anzüglichkeiten sexueller Art. So kümmert sich die Krankenschwester im Lazarett auf ganz besonders innige Wiese um ihren Patienten:
"Da beschäftigt sich die Tante noch genauer mit meiner Hose. Glauben Sie mir, was Sie wollen, aber ich werde ein bisschen steif. […] Die Schachtel befingert mich so gut und gekonnt, dass ich mich winde."
Die skurrilen Seiten des Lazarettlebens
Verzweiflung und Elend werden prall ausgemalt, aber eben auch die skurrilen Seiten des Lazarettlebens: hemmungslose Zechgelage, die florierende Prostitution und die Scheinheiligkeit der Militärseelsorge:
"Jeden Tag kam der Pfaffe vorbei. Drehte seine Kreise wie ein Geier, war aber nicht schwer zu befrieden. Eine kleine Beichte hier und da, schon war er glücklich. Er strahlte. Ich beichtete also. Natürlich erzählte ich nur unwesentliches Zeug."
Ferdinand entwickelt sich vom traumatisierten Schwerverletzten zum schelmischen Simulanten, dem es schließlich gelingt, auf einem Boot der alliierten Briten über den Ärmelkanal nach London zu entwischen.
Verschwundene Manuskripte
Dass der Roman so lange verschollen war, hat damit zu tun, dass der 1894 geborene Louis-Ferdinand Céline während des Zweiten Weltkriegs ein Anhänger des mit den Deutschen kollaborierenden Marschalls Pétain war. Als Paris im August 1944 befreit wurde, musste der Schriftsteller Hals über Kopf seine Wohnung im Stadtteil Montmartre verlassen. Viele seiner Manuskripte blieben in der Wohnung, die die Résistance requirierte.
Einer der Befreier nahm das Paket Handschriften an sich, verwahrte es bei sich zu Hause auf. Später landete es bei einem Journalisten, der es so lange unter Verschluss hielt, bis die Witwe des Schriftstellers im Alter von mehr als 100 Jahren gestorben war. Sie sollte vom Erbe des rechtslastigen Autors nicht auch noch finanziell profitieren. Denn Céline stand nicht nur der Vichy-Regierung nahe, er hatte seit Ende der 30er-Jahre auch wüste Pamphlete gegen Juden veröffentlicht.
Gespaltene Literaturwelt
Die französische Literaturwelt ist deswegen bis heute gespalten in eine Fraktion, die ihn und sein Werk vehement ablehnt – und diejenigen, die seine berserkerhafte, dem Volk aufs Maul schauende Sprache bewundern.
Der Roman ist eine Anklage gegen die Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs, aber auch ein satirisches Manifest gegen die militärischen, religiösen und bürgerlichen Institutionen, gegen Naivität und Hurrapatriotismus vieler Zivilisten:
"Ihre gewaltige optimistische, dämliche, verkommene Idiotie, mit der sie vor allen Offensichtlichkeiten die Augen verschlossen, ungeachtet aller Schande, aller schrecklichen, extremen, blutigen Leiden."
Ein anti-heroisches Werk
Die Umstände des Handschriftenfunds haben die ambivalente Stellung des genialen Schriftstellers und politisch reaktionären Menschen Céline noch einmal bewusst gemacht. Die mitunter derbe, aber unendlich farbige Alltagssprache, Célines Markenzeichen, mit der er der französischen Literatur so kräftige neue Impulse gegeben hat, hat der erfahrene Céline-Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel äußerst nuanciert ins Deutsche übertragen.
Der Roman ist ein wuchtiges, anti-heroisches Werk, das den Horror eines jeden Kriegs grell beleuchtet, ohne jemals sentimental zu werden.