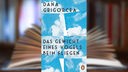"Föhrenwald, das vergessene Schtetl" von Alois Berger
Stand: 20.06.2023, 12:00 Uhr
Föhrenwald hieß die Siedlung im oberbayerischen Wolfratshausen, in der von 1945 bis 1957 jüdische Überlebende der nationalsozialistischen Konzentrationslager untergebracht waren. Der Journalist Alois Berger hat die Geschichte von Föhrenwald rekonstruiert. Eine Rezension von Wolfgang Stenke.
Alois Berger: Föhrenwald, das vergessene Schtetl
Ein verdrängtes Kapitel deutsch-jüdischer Nachkriegsgeschichte.
Piper Verlag, 2023.
237 Seiten, 24 Euro.
Verborgene Spuren
"Zwölf Jahre lang, von 1945 bis 1957, lebten in meiner Heimatstadt Wolfratshausen bis zu 5800 Juden – nach dem Krieg wohlgemerkt, nach Auschwitz, nach Treblinka und Dachau."
Der Journalist Alois Berger, Jahrgang 1957, ist in einer alpenländischen Postkartenlandschaft aufgewachsen: im oberbayerischen Wolfratshausen. Dass auch in dieser Kleinstadt die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts ihre Spuren hinterlassen hat, ist ihm lange verborgen geblieben.
Die Geschichte von Föhrenwald
Wolfratshausen war Standort einer Munitionsfabrik, in der im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene schuften mussten. Eingesperrt wurden sie in einem Lager, das ursprünglich als NS-Mustersiedlung geplant war: Föhrenwald. Nach Kriegsende brachten die Alliierten dort jüdische Zwangsarbeiter und Überlebende aus den Konzentrationslagern unter:
"Die Alliierten, die UNO und die Hilfsorganisationen sprachen von 'Displaced Persons' (kurz: DP), Menschen, die aus ihrer Heimat verschleppt worden waren. (…) Kasernen, Krankenhäuser, Klöster, Hotels und Schulen wurden für die notdürftige Unterbringung genutzt. (...) Föhrenwald war das Lager, das noch viele Jahre weiterbestand, als alle anderen längst Geschichte waren."
Das erfuhr der Journalist Alois Berger erst um das Jahr 2011 durch eine lokalhistorische Initiative. Sie hat dafür gesorgt, dass auf dem ehemaligen Lagergelände ein kleines Museum geschaffen wurde. Der Autor schreibt:
"In kurzer Zeit ist der Erinnerungsort zu einer Anlaufstelle für Juden aus aller Welt geworden, die hier aufgewachsen sind oder deren Eltern oder Großeltern hier eine Zeit lang gelebt hatten. Zunehmend kommen auch Einheimische, die wissen wollen, was da war, in Föhrenwald. Aber es gibt immer noch viele, die es nicht wissen wollen."
Das Schweigen brechen
Alois Berger wollte. Er hat alte Frauen aus Wolfratshausen befragt, die einst am Sabbat als sogenannte "Schabbesgojim‘" in den Haushalten der jüdischen ‚"Displaced Persons", der DPs, die Öfen versorgten, und ehemalige Föhrenwalder Lagerbewohner interviewt – in Tel Aviv und Jerusalem, in Frankfurt oder Berlin.
Er hat die Archive konsultiert und so erfahren, was in seiner Heimatstadt über Jahrzehnte beschwiegen worden ist.
Wohin nach dem Krieg?
Die Bewohner von Föhrenwald gehörten 1945 zu dem mehr als sieben Millionen großen Ausländerheer, mit dem das NS-Regime seine Kriegswirtschaft in Gang gehalten hatte. In einer riesigen Kraftanstrengung transportierten die Alliierten das Gros dieser "Displaced Persons" nach Kriegsende zurück in ihre Heimatländer.
In Deutschland blieben jene, die nicht wussten, wohin. Ihre Familien waren ausgelöscht, die Häuser zerstört. Bald kamen neue DPs hinzu: Juden, die im Osten im Untergrund überlebt hatten und 1946 im polnischen Kielce erneut zum Ziel eines Pogroms geworden waren.
"Ruhe würden sie nur finden in einem eigenen Staat, einem jüdischen Staat, in dem sie keine Angst mehr haben müssten, (…) von einer nichtjüdischen Mehrheit zum Sündenbock gemacht und massakriert zu werden."
Zukunftspläne
Das DP-Lager Föhrenwald wurde zu einem Zentrum zionistischer Aktivitäten. Hier bereiteten sich schon vor der Gründung des Staates Israel 1948 Juden auf die Reise nach Palästina vor. Andere organisierten ihre Auswanderung in die USA, nach Kanada oder Australien. Wobei nicht wenige an der Diagnose TBC scheiterten – die Aufnahmeländer wollten nur gesunde Immigranten.
Anschauliche Lokalhistorie
Alois Berger beschreibt Föhrenwald als einen Ort, an den sich viele, die dort ihre Kindheit verbrachten, gerne erinnern. Kinder öffneten den Überlebenden des Holocaust den Blick in eine bessere Zukunft. Fassbar wird diese Perspektive in Erinnerungsinterviews, die der Autor geführt hat.
Den, so wörtlich, "höflichen Antisemitismus" beim Umgang bundesdeutscher Behörden mit jüdischen DPs spart Berger nicht aus. Mit spürbarem Engagement ist Alois Berger ein sehr persönliches Buch gelungen, in dem sich die Lokalhistorie spiegelt. Es ist zugleich eine anschauliche Geschichte der jüdischen DPs in der Nachkriegszeit.