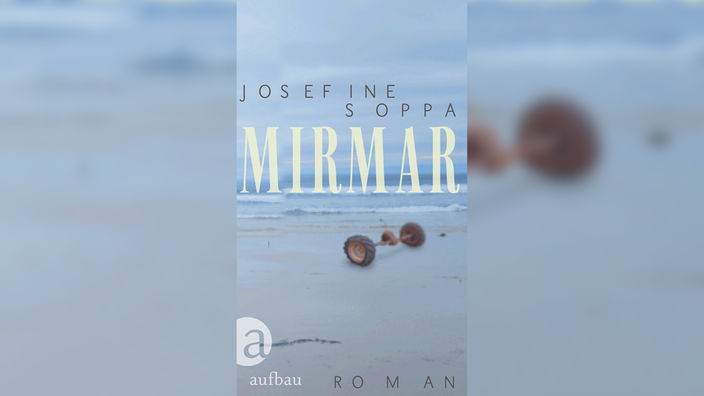
"Mirmar" von Josefine Soppa
Stand: 31.05.2023, 12:00 Uhr
"Lasst uns aufbrechen!" So in etwa könnte der Aufruf lauten, fasste man den Roman "Mirmar" in einem Satz zusammen. In Josefine Soppas Debüt brechen zuerst Mutter, später dann die Tochter buchstäblich zu neuen Ufern auf. Doch das Wort 'Aufbrechen' liest sich auch symbolisch, denn das Buch beinhaltet die politische Botschaft, vorhandene Strukturen, die Frauen benachteiligen, aufzubrechen. Eine Rezension von Michelle Clermont.
Josefine Soppa: Mirmar
Aufbau Verlag, 2023.
224 Seiten, 22 Euro.
"Ich mache die Jobs dazwischen. Ich mache die Jobs der Studentinnen. Ich mache die Jobs der Rentnerinnen. Ich mache sie über kurz oder lang, ich mache sie, bis ich weiter muss. Ich mache die Jobs weiterhin. Es ist Saison. Es gibt immer eine Saison. Ich bin selbstständig. Ich bin wahlweise 18, wahlweise 32, wahlweise 46, wahlweise müsste ich in Rente sein. Ich kann nicht mehr. Ich habe noch gar nicht richtig angefangen."
Wie Schnappatmungen lesen sich manche Passagen aus Josefine Soppas Debüt. Das passt gut zum Inhalt, denn atemlos ist auch die namenlose Ich-Erzählerin. Die hastet von einem ebenso prekären wie sinnentleerten Job zum nächsten, zwischendurch knetet sie fremde Rücken auf einer Massageliege. Ihre Mutter, mit der sie sich bis vor kurzem Job und Wohnung geteilt hat, ist verschwunden. Um ihrer Tochter nicht nur Last zu fallen und weil der Arbeitsmarkt nach jahrelanger Ausbeutung nichts mehr mit ihr anzufangen wusste. Aus der Ferne beschreibt die Erzählerin, wie sie zusammen mit anderen Frauen und fernab jeglicher kapitalistisch orientierter Produktivität, an einem entlegenen Strand, einem ehemaligen Erholungsort lebt.
Die Freundin der Erzählerin, deren Job darin besteht, tagein, tagaus, Hate-Speech von No-Hate-Speech zu trennen, ermutigt sie darin, ebenfalls aufzubrechen. Regelmäßig sendet sie ihr Geschichten über Frauen, die alles hinter sich lassen, als Notizen auf ihr Handy. Wie kleine Legenden unterbrechen sie den Lesefluss und tragen dazu bei, dass sich der Roman stellenweise liest wie eine Utopie. Tatsächlich bleibt dieser Mythos der aufbrechenden Frauen für die Leser*innen zu anfangs relativ abstrakt. Das ändert sich, als auch die Freundin sich den aufbrechenden Frauen anschließt und es der Protagonistin gelingt, aus dem Hamsterrad auszusteigen.
"Ich schreibe ich kann nicht mehr in eine Zeile, wie ein anonymer Witz. Wie lange wird es dauern, bis die Zeile auffällt. Wer wird sie lesen, welche Koordinatorin wird sie vielleicht unauffällig löschen, um kein Aufsehen zu machen. Bevor ich die Zeile rückgängig machen kann, melde ich mich ab. Ich lösche meine Anmeldedaten. Ich habe gar nichts, was ich aufgeben muss, wenn ich aufgebe."
Die Erzählerin, die bisher nur das ‚Durchhalten‘ kannte, irrt plan- und orientierungslos durch die Stadt. Sie strandet in einer Kneipe, wo sie bei einer feucht-fröhlichen Zusammenkunft eine Frau kennenlernt, die ihr von der Pension erzählt. Das ist der Ort, an dem sich die Frauen vor ihrem gemeinsamen Aufbruch versammeln. Die Erzählerin kennt die Pension, die sich in ihrer Heimat befindet. Und so führt die Reise sie erst einmal in die Vergangenheit, zurück zu den eigenen Wurzeln, in das Arbeiterviertel, in dem ihre Mutter aufgewachsen ist: einer ehemaligen Zeche.
"Die Pension ist in dem Ort, der für Regeneration da ist, für eine Kur, für eine Aufbewahrung und für eine Genesung oder Wiederherstellung. Es gibt hier importierte Sole, wie es vorher Kohle gab. Die Mutter meiner Mutter kam aus der Kohle. Ihr Besitz, in Form der Rentenpension und dem Anrecht auf lebenslanges Wohnen in der Wohnung, war aus der Kohle, in der ihr Mann war. Meine Oma kam aus dem Putzen und kam aus dem Putzen nicht raus."
Wie so oft in der Literatur, ist auch in ‚Mirmar‘ die Suche nach Identität eng verbunden mit der eigenen Herkunft. Hier spielt vor allem die Beziehung zwischen Tochter und Mutter eine große Rolle, die von Josefine Soppa nuanciert und feinfühlig beschrieben wird. In der Pension angekommen und dem Zusammenbruch nah, erinnert sich die Erzählerin auch an ihre Großmutter. Sie spürt nach, inwiefern sich Existenzängste und Gefühle der eigenen Unzulänglichkeit in den Habitus einschreiben und vererbt werden.
Einfühlsam und engagiert erzählt Josefine Soppa von ihren weiblichen Figuren und von einer ungleichen Gesellschaft, die sie benachteiligt, sie erzählt von Prekarität und Aussichtslosigkeit. Sie tut dies, ohne anzuklagen, augenzwinkernd und ironisch, niemals kitschig. Das Anliegen des Buches, das ein politisches, feministisches ist, verliert dadurch aber nicht an Ernsthaftigkeit. Dem Roman "Mirmar" liegt die Idee der weiblichen Solidarität zugrunde. Einer Solidarität, die keinen Aufstand probt, sondern sich einer Gesellschaft, die ihr nichts zurückgibt, entzieht. Dass die Leser*innen weder den Namen der Erzählerin noch die von den anderen Figuren erfahren, ist dabei nur konsequent, denn es verstärkt den Gedanken der Kollektivität. Josefine Soppa hat ein eindringliches Debüt geschrieben, das auch mit Innovation und Witz überrascht.










